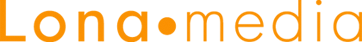Kritik zu Eine einsame Stadt
27.11.2020
Silvia Hallensleben
zurück zur Auswahl
Die Anonymität der Großstadt ist nur einer der Faktoren, die im neuen Dokumentarfilm von Nicola Graef über Berliner, Berlinerinnen und das Alleinsein eine Rolle spielen
Zu Anfang der zweiten Corona-Welle galt Berlin vielerorts als Sodom und Gomorra feierwütiger Partygänger. Vor zwei Jahren dagegen stand mit der Einsamkeit vieler Bewohnerinnen und Bewohner eher die Gegenseite großstädtischen Alltags im kritischen Fokus: Diese Zuschreibungen dürften auch diesen Dokumentarfilm inspiriert haben, der eine gute Handvoll solcher Lonely Hearts eine Zeit begleitet – und jetzt fast zu gut zum aktuellen Corona-Blues passt.
Versammelt hat Regisseurin Nicola Graef (»Neo Rauch – Gefährten und Begleiter«) Berlinerinnen und Berliner, die sich aus den verschiedensten Gründen und in unterschiedlichen Formen selbst als mehr oder weniger bedürftig offenbaren: Da ist die Abiturientin, die ihre Grübelei selbst eine »Spirale aus Selbstmitleid« nennt. Die alleinerziehende junge Mutter, die auf Kontakte zu anderen in gleicher Lage hofft. Der aus einer langjährigen Beziehung geworfene Künstler in mittleren Jahren, der in Floskeln des Geschäftslebens über die Liebe redet (»Es gibt für alles einen Markt, auch für kaputte Autos«). Ein verwitweter Gewichtheber, der in der Ersatzfamilie seines Sportvereins der Leere trotzt, doch das Heimkommen fürchtet. Und eine Yogalehrerin, deren dementer Partner ihr Zuhause zum Ort der Belastung statt der Entspannung werden lässt.
Als Kontrapunkt treten auch einige Menschen auf (alles Männer), die das Alleinsein gewählt haben und sich nicht als einsam verstehen. Näher fokussiert wird dabei aber nur eine Person: Der 85-jährige Fotograf Efraim Habermann, der seine Näheeinheiten im Wilmersdorfer Café Manzini und in der Jüdischen Gemeinde findet und von sich selbst sagt, er könne »sich mit Menschen nicht lange befassen« – und dass Frauen ihn wie wechselnde Landschaften inspirieren. Schade, dass für den Film nicht auch eine weibliche Subjektivität gefunden werden konnte, die auf ähnliche Art mit sich im Reinen ist.
Die Frage nach der Verantwortlichkeit für die Einsamkeit adressiert Graefs Film einerseits über die einzelnen Protagonist:innen, von denen einige Wege zur Veränderung ihrer Lage finden. In der personalisierenden Behauptung des Titels (und einigen Statements im Film) wird aber auch dem Großstadtleben und den neuen Social-Media- und Tinder-Zeiten Schuld zugeschrieben.
So ist »Eine einsame Stadt« ein Berlin-Film, der sich topologisch merkwürdig auf Wilmersdorf fixiert und die migrantische Vielfalt der Stadt und ihrer Quartiere fast komplett ausblendet. Doch interessanterweise spielt bei den im Film erzählten Schicksalen die Stadt nirgendwo eine treibende oder gar ursächliche Rolle, im Gegenteil scheinen ihre Institutionen und Orte den Einzelnen eher Halt zu geben. So steht hier der Titel gegen den erzählten Inhalt – und auch die komplexe Realität selbst. Denn die Anonymität der Großstadt, die ein S-Bahn-Führer im Film beklagt, ist für viele auch Befreiung. Einsam sein lässt sich auch in Hintertupfingen gut für die mit einem nicht angepassten Lebensstil.
zurück zur Auswahl